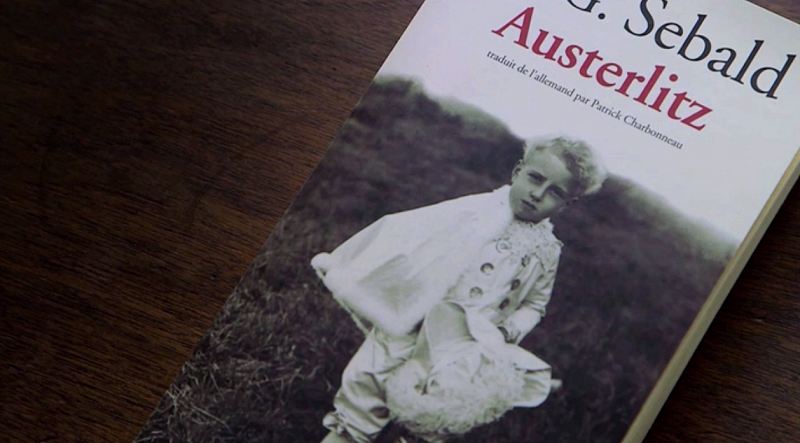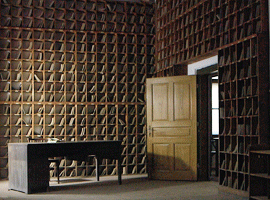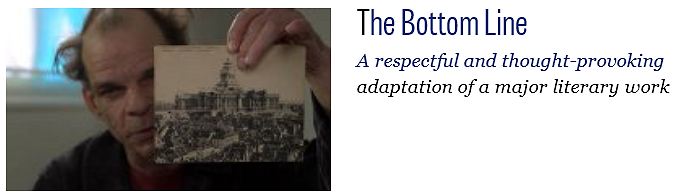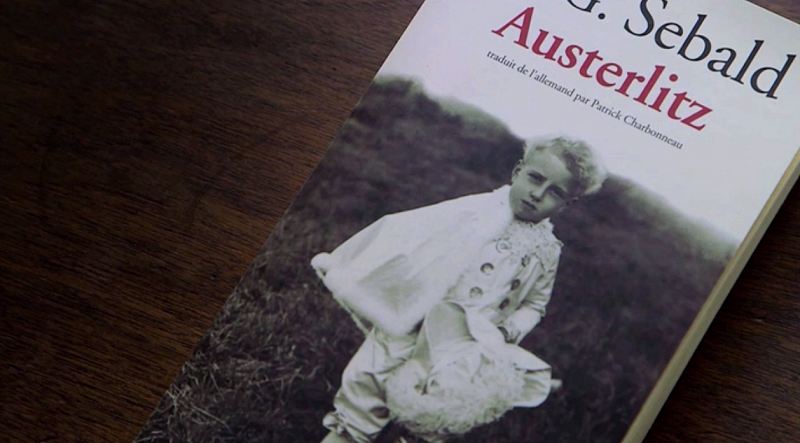

Austerlitz
Eines Tages fällt dem französischen Filmemacher Stan Neumann Austerlitz in die Hände. Er findet im Buch den Amateurfotografen und passionierten Sammler aller Arten von Bildern Jacques Austerlitz, brillanter Kunsthistoriker mit ausgefallenen Ideen, besessen von der monumentalen Architektur des 19. Jahrhunderts. Doch Austerlitz quält auch das schreckliche Gefühl der Leere: seine eigene Herkunft kennt er nicht, hat keinerlei Erinnerung an seine ersten Lebensjahre - bis er eines Tages eine Spur findet ...
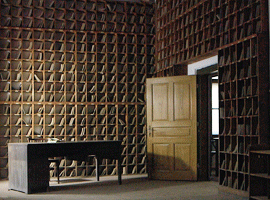
Der Film "Austerlitz" - gesendet 2015 auf ARTE - zeichnet Jacques Austerlitz’ Suche nach den Geheimnissen seiner Herkunft nach. Sein Weg führt ihn von Antwerpen nach London, von Paris nach Marienbad und von Prag ins KZ Theresienstadt. Und in den Abgründen der Geschichte findet Neumann auch die verlorenen Bruchstücke seiner eigenen und der kollektiven Erinnerung wieder.
Das Werk Stan Neumanns mit vielen wörtlichen Zitaten und einer schier unglaublichen Zahl an Fotografien und Filmszenen macht eine elementare Seite von Sebalds Opus Magnum lebendig und sichtbar.
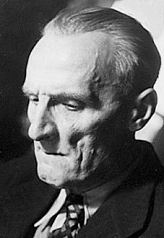 Stanislav Kostka Neumann (1875 - 1947),
Stanislav Kostka Neumann (1875 - 1947),
Prager, wird 1894 im Omladina-Prozess als einer der geistigen Führer der Bewegung zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, beginnt danach zu dichten - zuerst auf Latein - und danach unter mindestens 25 Pseudonymen, ist Anarchist und begründet die tschechoslowakische kommunistische Partei mit.
 (1902 – 1975), der Sohn von Kostka, (1902 – 1975), der Sohn von Kostka,
Bühnen- und Filmschauspieler, auch Kommunist, gehört zur Prager Prominenz.
 Dessen Sohn Stanislav Neumann (1927 - 1970) Dessen Sohn Stanislav Neumann (1927 - 1970)
verhaften, als er 16 ist, die deutschen Nazis zusammen mit einer Gruppe von etwa 50 Gymnasiasten, bringen sie nach Theresienstadt und am 2. Mai 1945 erschießen sie die ganze Gruppe - Neumann überlebt als einziger - weil er Typhus hat.
Vom kleinen Funktionär steigt er zum Kulturattaché auf, bricht nach 1968, als die Sowjets in Prag einmarschieren, mit der Partei und begeht Selbstmord.
Sohn Stan Neumann, geboren 1949 in Prag, geht 1959 mit dem Bruder und seiner amerikanischen Mutter Claudia Ancelot (geschieden, 1933 aus Deutschland emigrierte Jüdin, die bei Radio Prag und als Übersetzerin arbeitet) nach Frankreich. Nach dem Prager Frühling verbringt Stan alle seinen Ferien bei den Verwandten in Prag, fühlt sich in der Stadt an der Moldau mehr zuhause als in Paris. Dreht 1996 den bekannten Dokumentarfilm
 A house in Prague. A house in Prague.
Eine Villa in Žižkov, wo sein Urgroßvater zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine anarchistische Kommune gründete und seine Nachkommen lebten. Als der Fimemacher sich vertieft in das Dasein des Hauses und seiner Bewohner, fängt er an zu erkennen, dass die Situationen viel komplexer, schwieriger, in einer bestimmten Art und Weise schmerzhafter, aber auch viel lebendiger waren als heute. Und das war - wie die Folge aller seiner größeren Filme - in einer bestimmten Art und Weise Befreiung für ihn.
|
|
Manchmal kauft man ein Buch und lässt es eine Zeit lang liegen. Irgendwann öffnet man es, gedankenverloren, und steht auf einmal dem größten Geheimnis gegenüber, das man selbst tief im Inneren trägt. Genau das ist mir mit "Austerlitz" passiert, dem Buch von Sebald. Ich hatte wegen des Titels und des Buchumschlages einen historischen Roman erwartet. Stattdessen fand ich eine seltsam vertraute Geschichte mit deren Schwarz-Weiß-Fotografien und ihrem Interesse für die Architektur des 19. Jahrhunderts, vor allem für große Bahnhöfe, wie dem von Antwerpen, dem Ort der ersten Begegnung mit dem Titelhelden.
Zum Film 
Interview mit Stan Neumann 
|
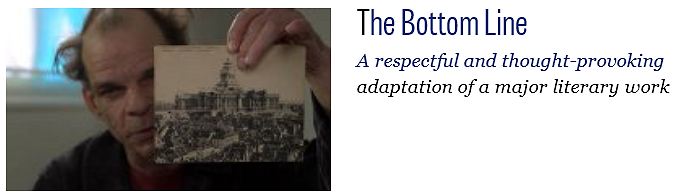
Susan Sontag beginnt ihr Essay über W.G. Sebald mit der Frage: "Ist literarische Größe noch möglich?" Die Antwort war zweifelsfrei ja, und sie beschreibt die brillante Art und Weise, in der Sebald Fakten und Fiktion in einer Reihe von Büchern mischte, die die zerstörerische Vergangenheit Europas durch die melancholischen Wanderungen eines Erzählers - oft des Autors selbst - aufarbeiten.
Sebalds letzter Roman Austerlitz erscheint im Jahr seines Todes und ist jetzt Gegenstand der Verfilmung des in Paris lebenden tschechischen Regisseurs Stan Neumann, in der Denis Lavant den Titelhelden spielt. Indem Neumann die Darstellung von Erinnerung, Verlust, Schöpfung und Verwüstung durch Erzähltechniken - Fotografien, Archive und Meta-Fiktionen -, die den Originaltext nachahmen, erneut aufgreift, schafft er eine würdige Hommage an einen modernen Literaturriesen, die Feste, Museen und Nischenkunsthäuser finden sollte.
Der im Jahr 2000 veröffentlichte Roman vereint viele der Lieblingsthemen des Autors in einer einzigen Figur: Austerlitz (Lavant), ein wandernder Gelehrter, der zur Architektur des 19. im Zusammenhang mit der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs forscht.
Sowohl Roman als auch Film führen uns durch die erschütternde Geschichte Europas, mit Stationen in Brüssel, Greenwich, Antwerpen, Marienbad, Prag und Paris, obwohl der Film einen zusätzlichen Metaschritt macht, indem er Sebald selbst zu einem weiteren Thema der Geschichte macht. Angefangen damit, dass Neumann beschreibt, wie er zum ersten Mal zu dem Roman kam, und Szenen, in denen er die Prosa des Autors seziert (und dabei starke Anleihen bei Marcel Proust, Franz Kafka und Walter Benjamin entdeckt), ist der Film weniger ein verfilmtes Buch als ein Film über das Buch, der die Mauern einreißt, die Dokumentarfilm und Fiktion trennen, so wie Sebald die Grenzen zwischen beiden in seinem Schreiben verwischt.
Es ist eine besondere Technik, die Zuschauer abschrecken könnte, die entweder das eine oder andere Genre bevorzugen, aber sie bietet bald ihre Belohnung, wenn wir Austerlitz durch seine vielen Abschweifungen und Obsessionen folgen - mit Bahnhöfen, versteckten Türen, zugemauerten Fenstern und verzierten Fassaden - bis er zum Kern seiner Geschichte gelangt, und wir erfahren, wie scheinbar intellektuelle Beschäftigungen ihn dazu bringen könnten, die dunklen Geheimnisse seines eigenen Lebens zu lüften. Nochmals das Buch übertreffend, fügt Neumann in diesen letzten Abschnitten Details seiner persönlichen Geschichte ein und vermischt so Filmautor mit Autor und Hauptfigur des Romans.
Indem er Sebalds Text direkt in die Kamera rezitiert, gibt Lavant eine seiner typisch körperlichen Performances und porträtiert einen wahnsinnigen Gelehrten, der zwischen Faszination und Verzweiflung schwankt, während er verschiedene kulturelle Artefakte ausgräbt, die mit seiner Vergangenheit in Resonanz stehen. Neumann fügt viele der Fotos aus dem Originalbuch ein - eines der Markenzeichen von Sebalds Stil - und fügt einige weitere Elemente hinzu, darunter Filmmaterial aus einem Propagandafilm der Nazis über das KZ Theresienstadt.
Während die Mischung aus Fotografie und Film nichts Neues ist (es gibt Momente in Austerlitz, die an die Arbeit von Chris Marker erinnern), nutzt Neumann die Stimme von Sebald, um seiner Bildsprache ein besonderes Gewicht zu verleihen, auch wenn sich die HD-Linsen (von Ned Burgess) im Vergleich zum Rest des Materials manchmal zu knallig anfühlen. Das Ergebnis ist vielleicht, was man über das Lesen des Originaltextes hinaus noch erreichen kann – immer respektvoll gegenüber den Worten des Autors, wenn Neumann das Schreiben geschickt und bewegend auf die große Leinwand übersetzt.
Jordan Mintzer

|